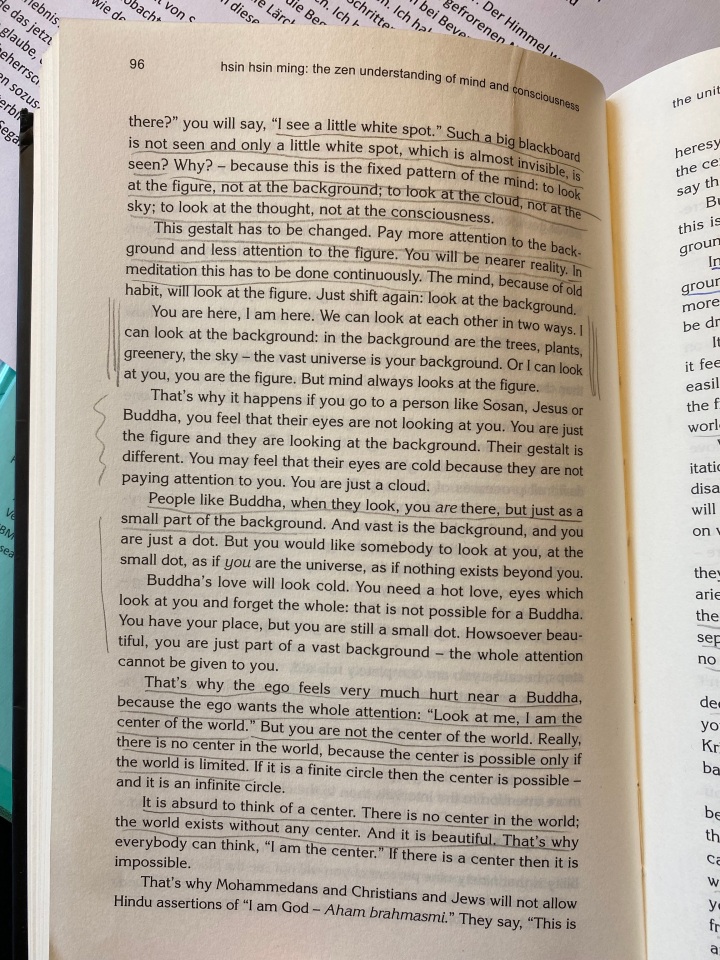Die Lösungen für uns dringlich erscheinende Probleme wie Klimakrise, Brexit, Artensterben, Überschuldung, Migration – sie sind bereits da.
Wir brauchen nicht mehr länger nach Lösungen zu suchen. Wir werden keine finden, weil sie bereits da sind. «Es gibt keine Lösungen, weil es bereits gelöst ist.»
Halte hier einen Moment inne – wie fühlt sich das an?
Es wäre erleichternd, beruhigend, entspannend.
Wir könnten uns der Gegenwart zuwenden, anstatt mit Blick auf die Vergangenheit etwas für die Zukunft hinzubiegen.
Wir müssten weniger streiten.
Wir könnten wieder Vertrauen schöpfen, in uns, in unsere Mitmenschen, ins Leben selbst.
Wir könnten uns darauf besinnen, wofür wir eigentlich hier auf der Erde sind; was unsere Bestimmung ist.
Klingt gut, oder?
Eingefallen ist mir dieser Satz beim Lesen des neuen Buchs von Richard Powers «Die Wurzeln des Lebens». Aber aus heiterem Buch, beziehungsweise heiterem Himmel kommt dieser Satz nicht. Dahinter steckt so ungefähr meine ganze Lebensgeschichte. Ich habe mein ganzes Leben lang nach Lösungen gesucht. Für persönliche Probleme, für Weltprobleme, für Probleme im Geschäft und bei Projekten, die ich mir ausgedacht hatte. Gelöst hat sich dadurch nichts wirklich. Die Welt konnte ich so nicht retten.
Aber: Ich lebe noch! Die Welt dreht sich noch immer! Und auch unser Business funktioniert und generiert Wohlstand. Weil ich noch lebe, die Welt sich noch dreht und das Geschäft weiterhin läuft, scheint der Satz: «Es gibt keine Lösung, weil es bereits gelöst ist.», gar nicht so weit hergeholt. Denn hätte es wirklich diese Lösungen gebraucht, so wie ich das immer gemeint habe, dann wäre ich entweder tot oder bankrott und die Welt hätte mit Drehen aufgehört.
(Ich) Wir können Weltprobleme wie die Klimakrise, das Artensterben, die weltweite Überschuldung, die Völkerwanderungen nicht lösen. Ich kann sie nicht lösen, aber auch wir als Weltgemeinschaft können sie nicht lösen. Sie lösen zu wollen ist nicht nur anmassend, sondern schlicht grössenwahnsinnig. Zu meinen, wir könnten zum Beispiel die globale Erwärmung stoppen oder rückgängig machen, zeugt von einem Weltverständnis, das die 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte ignoriert. (Und nebenbei gesagt die 700 Millionen (!!!) psychisch Kranken erklärt, die es laut Weltgesundheitsorganisation heute gibt.)
Schauen wir doch mal zum Fenster hinaus. Dort futtert eine Kohlmeise die Sonnenblumenkerne, die ich für sie bereitgelegt habe. Damit diese Kohlmeise zu dem wurde, was sie heute ist, brauchte sie Zeit. Nicht hundert Jahre. Nicht tausend Jahre. Nicht zehntausend Jahre. Nicht hunderttausend Jahre. (Damit sind wir erdgeschichtlich im Zeitraum angelangt, wo der Homo sapiens erscheint). Aber die Vögel und damit unsere Kohlmeise ist noch viel älter. Nicht eine Million, nicht zehn Millionen, sondern 120 Millionen Jahre alt. Dort passierte der erste Flügelschlag. Heute bringen Teile der Menschheit (vor allem reiche, weisse Menschen) gewisse Vogelarten zum Aussterben. Andere Teile der Menschheit (vor allem reiche, weisse) wollen diese aussterbenden Arten retten. Beides ist vermessen. Es ist vermessen, Arten zu zerstören, die sich über Millionen von Jahren hinweg entwickelt haben. Und es ist vermessen zu glauben, man könne eine Entwicklung stoppen, die ebenfalls über Millionen von Jahren gelaufen ist. Da der Mensch Teil dieser Entwicklung ist, wird er sich dieser Entwicklung nicht entziehen können.
Diese Entwicklung wird weitergehen, vor allem darauf kann man sich verlassen. Der Kosmos wird sich weiter differenzieren, wird weiterentwickelte Formen hervorbringen. Falls der Mensch dem im Wege stehen sollte, wird es ohne ihn weitergehen. Deshalb sage ich, es gibt keine Lösung, weil alles bereits gelöst ist. Die Entwicklung läuft. Der Mensch pumpt CO2 in die Luft – das System reagiert mit einer Klimaerwärmung, die dem Menschen die Lebensgrundlagen entzieht. Der Mensch rottet Arten aus – die Entwicklung reagiert mit ein paar Pilzen oder «Schädlingen», die genau jene Arten zerstören, auf die sich der Mensch bei seiner Nahrungsmittelproduktion fokussiert hat. Die Menschen verschulden sich (Individuen, Unternehmen, Staaten) – das System reagiert mit einer Finanzkrise – und diejenige von 2008 wird nicht die letzte gewesen sein. Die Entwicklung ist nicht nur viel kreativer und viel potenter als wir, sie hat sich auch darauf eingestellt, uns überflüssig zu machen, falls wir überflüssig sein sollten.
ABER: Wir sind nicht ersetzbar. Genauso wenig wie die Kohlmeise ersetzbar ist. Doch wenn wir die Weiterentwicklung behindern, dann ist der Kosmos absolut verlässlich und wird neue Möglichkeiten finden, um das zu verwirklichen, was er mit dem Menschen vorhatte. Ändert diese Sicht etwas an unserer Situation?
Ich glaube schon. Erstens müssen wir nicht Angst haben, dass wir ALLES zerstören. Dazu nur zwei Zahlen: Die Masse aller Lebewesen auf der Erde beträgt 1800 Milliarden Tonnen; die Masse aller Menschen beträgt hingegen nur 0,4 Milliarden Tonnen. ALLES ist viel, viel grösser als wir. Was wir hier im Moment tun ist vielleicht Selbstmord (davor kann man Angst haben), aber es erschüttert die Entwicklung der Welt nicht in ihren Grundfesten. Wenn diese Einsicht in ihrer ganzen Klarheit da ist, ergibt sich daraus sicherlich nicht das neue Motto «nach mir die Sintflut», sondern eine Haltung der Demut.
Zweitens stellt sich die Frage, ob es wirklich unsere Bestimmung ist Selbstmord zu verüben? Sind wir Menschen deshalb auf die Welt gekommen? Um das System zu testen? Um herauszufinden, ob die kosmische Entwicklung clever genug ist, Störenfriede wie uns gleich wieder auszuschalten?
Wenn nein, wozu sind wir denn da?
(Teil 2 bald hier auf diesem Blog)