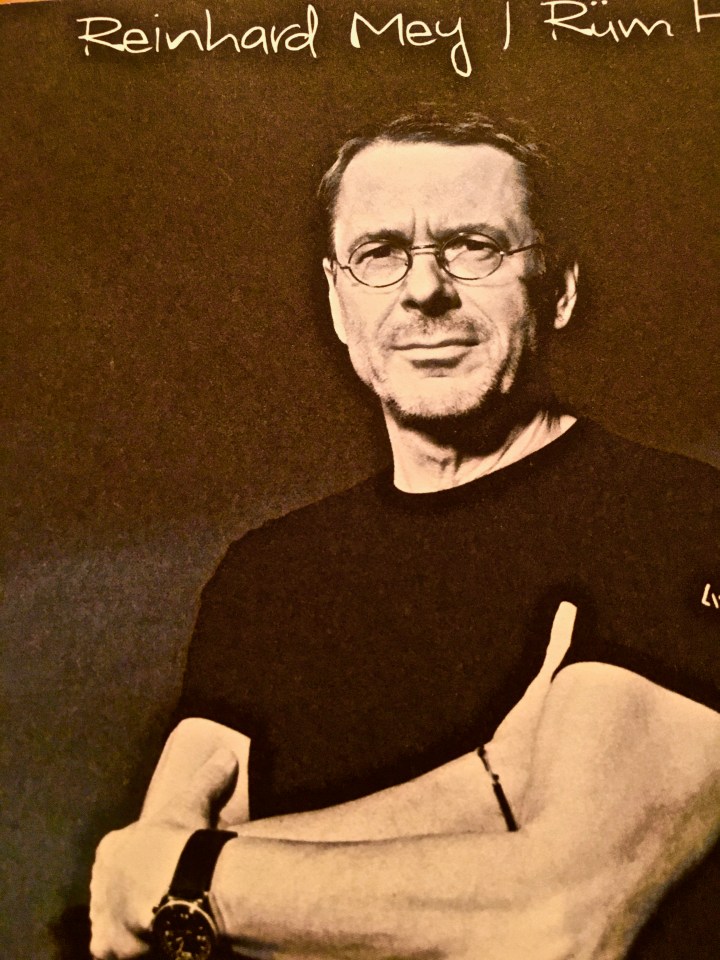Eine Zeit lang bin ich jeden Donnerstagmorgen in unseren Garten gegangen und habe dort zwanzig Minuten lang achtsam gearbeitet; mal Rosen geschnitten, mal Wege gejätet, mal Beeren angebunden, … Das hat mir sehr viel Ruhe in den Alltag gebracht. So viel, dass ich über diese stillen zwanzig Minuten ein kleines Buch geschrieben habe. «Meditatives Gärtnern» (https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Meditatives+G%C3%A4rtnern)
Es sind kurze Texte. Einer davon ist der Folgende:
Sechs Uhr in der Früh. Der Garten ist ohne mich gewachsen in den vergangenen zwei Monaten. Das tut er, einfach so. Das Leben darin hat sich ohne mich abgespielt. Ich stand daneben, einfach so.
Jetzt versuche ich, wieder hinein zu kommen. Die Stille ist schon da, wie sie es immer ist. Sie wartet nur auf mich. Ich gehe hinein. Es hat geregnet in der Nacht. Jetzt donnert es. Ich gehe ein Stück des Weges in den Garten, atme, spüre, wie der Atem kommt und geht, aber nicht fliesst. Dann beginnt es zu tröpfeln. Das Räucherwerk, das ich in den Händen halte, darf nicht nass werden – ich gehe zurück, stelle mich unter das Garagendach, lege das Räucherwerk ins Trockene.
Nur ein warmer Sommerregen, denke ich. Den Hut habe ich vergessen. Ich trete wieder hinaus, spüre die Tropfen auf meinem Schädel, hole die Grasschere und beginne mit Gras schneiden rund um die kleine Buddhastatue aus Stein. Die Messer wetzen gegeneinander, ritsch-ratsch, schön regelmässig. Der Regen hat die Halme gebeugt, gerade so, dass ich deutlich sehen kann, wo ich zu schneiden habe. Ritsch-ratsch ist ein leises, schönes Geräusch, nicht unähnlich demjenigen einer Sichel. Ich schneide gebückt die zwei Quadratmeter, denke an die Millionen von Sicheln, die jetzt gerade, im selben Augenblick den Reis schneiden in Asien, fühle mich verbunden, vergessen ist der Regen, ritsch-ratsch.
Der Buddha kommt frei. Ich hole das tiefgelbe Tuch, das mir eine Leserin geschenkt hat, um unseren Buddha zu schmücken. Es liegt noch im Trockenen. Ich binde es ihm um die Schultern. Es ist Licht. Ich hole die Räucherstäbchen, die sie mitgegeben hat und zünde sie an, trotz Regen. Dann trete ich drei Schritte zurück und blicke ihn an. Ich weiss, dass es nicht stimmt, aber er lächelt jetzt etwas breiter, schaut etwas zufriedener, befreit von Gras und zwei Schnecken, geschmückt mit einem leuchtenden Tuch und dem süsslichen Duft seiner Heimat in der Nase.
Ich lächle auch. Es regnet trotzdem. Ich bin nass. Es ist gut so. Ich gehe zurück, putze die Grasschere und lege sie zurück in den Schrank. Jetzt ist die Achtsamkeit da. Ich spüre, wie die Streichhölzer in meiner Hosentasche gegen den Schenkel drücken, gehe nochmals zurück, um auch sie an ihren Ort zu verstauen. Und weil ich dafür nochmals in den Regen hinaustreten muss, werde ich nochmals nass und genau in diesem Augenblick bin ich verbunden mit all den vielen, die durchhalten, die Disziplin üben, die tun, was getan werden muss, ob es regnet oder schneit, auch wenn es dunkel ist und mühselig und nichts als ihre Pflicht, ihr Tun an dem Ort, an den sie hingekommen sind.
Ihnen widme ich diese Zeilen. Und ihnen wünsche ich, dass sie beschenkt werden, wie ich heute, mit einem hellen, gelben Tuch, das Licht in den Regentag bringt.
(geschrieben am 29.6.06)